"Pantalon"
und die Faszination der fliegenden Hämmer
Der Begriff Pantalon
Das Spiel der „fliegenden Hämmer“ lag in der Luft
seitdem Pantaleon Hebenstreit 1714 in Dresden zum Hofkapellmeister
ernannt wurde. 1667 in Eisleben geboren, war Geiger und Tanzlehrer und
ab 1714 Kammermusikus August des Starken in Dresden. Hebenstreits Ruhm
gründetet sich auf akrobatischen Fähigkeiten auf dem
Hackbrett. Kein anderer beherrschte dieses Hackbrett in solcher
Perfektion. Der Umfang des Instruments war der eines Cembalos, die
Größe von fast drei Metern war gewaltig, Es war mit
gegenüberliegendem Darm- und Metallsaitenbezug versehen, wie jedes
Hackbrett wurde es mit verschiedenen Hämmern gespielt,
Sein Instrument ließ sich Hebenstreit von Gottfried Silbermann
bauen und erwirkte im Streit um die weitere Vermarktung ein
königliches Dekret gegen Silbermann.
Hebenstreit- offenbar ein genialer Geschäftsmann hat sich
vorausblickend gegen Konkurrenten geschützt und furios in Szene
gesetzt. Für seinen Kapellmeistertitel kassierte er ein
Jahresgehalt von 1200 Gulden, der Organist bekam dagegen 65 Gulden im
Jahr, dafür musste Hebenstreit aber auch ein mal im Jahr vor
dem König spielen (Offenbar zelebrierte er meisterlich die
Wertsteigerung durch Verknappung) Seine Tourneen wurden in vielen
Ländern gefeiert, dabei war noch wenige Jahre vor ihm das
Hackbrett ein Instrument der Bettler und Gaukler.
Michael Praetorius nennt es
„das Hackebret, ein Dörfliches oder Lumpen Instrumenta!
Ein weiterer Bericht stammt aus Bayern:
„In allen Löchern stecken Musikanten, die den Leuten eins
vorgeigen... Da kommt ein Einaugiger und darauf ein Blinder und gleich
wieder ein Bucklichter, und das sind lauter Virtuosen auf der Harpfen,
und Gsichter schneiden’s beim Singen, wie ein B’sessener.
Draf kommt ein Herr, der blast ein Fagott auf einem Haslingerstecken,
und der gibt d’Tür ein’ andern Herrn in der Hand, der
eine türkische Musik macht, dass dem Herrn Vetter s Hören und
s Sehen vergeht und diesen Herrn löst eine Wälische a, die
hat ein Hackbrett und schlagt uns Triller, trotz der Frau Mam ihrer
schwarzen Katz.“
Das Pantalon Clavier- vom Hackbrett zum Hammerklavier
Historische Quellen, Berichte und Anzeigen verwenden den Begriff
Pantalon um 1750 scheinbar sehr frei- für Hackbrett oder
Clavierinstrumente. Ihren Ursprung hat die Bezeichnung im Vornamen des
Hackbrett- Virtuosen Pantaleon Hebenstreit. Demnach galt der Name
zunächst dessem riesigen Hackbrett, ging aber bald auf
Clavierinstrumente über. Die Begriffsverwirrung der doch
grundlegend
verschiedenen Anschlagsarten hat ihre Ursache sicherlich in dem
Bestreben, das faszinierende, aber akrobatische Hackbrettspiel
durch eine zwischengeschaltete Mechanik den Clavierspielern
zugänglich zu machen. Vermutlich wurde unter dem Titel
Pantalon mit unterschiedlichsten Mechanikformen experimentiert, welche
als Verbindungsglied zum Hammerclavier eine fließende
Bedeutungsverlagerung begründen. 1731 wird in einer der
frühesten Quellen noch explizit auf die Vorbild- Funktion des
"hochberühmten Pandalon" (Hebenstreit) hingewiesen und eine, dem
Vorbild besonders nahestehende oberschlägige Mechanik vorgestellt:
„Deren
Liebhabern der edlen Musique dienet zur Nachricht, das von dem Orgel-
und Instrument- Macher, Nahmens Wahl Friedrich Fickern in Zeitz,
abermahl ein neu musicalisches Instrument inventariet und
verfertiget worden, welches Cymbal-Clavier genennet wird; es ist in
Form ein 16-füßigen Clavicymbels, und 4 Chörig, met
Draht-Saiten bezogen; an Gravität un Force übertrifft es den
stärcksten Clavicymbel, und stehet in der Stimmung so lange, als
ein gut Clavichordium ohne die geringste Accomodirung, lässet sich
also leichte tractiren, da doch die Hämmergen auf 2 ½ Zoll
von oben herab auf die Saiten schlagen. Überdiß hat es auch
einige Veränderungen: 1) eine angenehme Dämpfung, als ob mit
betuchten Hämmergen gespielet würde; 2) kan man auch,
vermittelst eines Zuges, das Untereinandersausen in währenden
Spielen verhindern, gleichwie das Tuch in der Tangente eines
Clavicymbels die Saite stille machet. Dieses Instrument, welches um
einen civilen Preiß zu haben, hat die Eigenschafft des von dem
hochberühmten Pandalon erfunden Cymbals, und ist von vielen
Virtuosen admiriret und approbiret worden.“
Clavier- Instrumente unter dem Namen Pantalon, Pandalong, Pandaleon,
Pantalon- Clavier wurden nach historischen Berichten in zunehmend
großer Zahl zwischen 1730 bis nach 1800 gebaut.
„Pantalongs von
allerley Facon und Größe, dessen sehr lieblichen Töne,
ohne den sonstigen Nachklang, nunmehro gleich einem Clavicimbel
tractiert werden können, und dahero in allen Concerten mit Nutzen
zu gebrauchen sind, nicht allein, weil aller unzeitiger Nachklang
gedämpfet, worauf bereits viele speculiret und nicht erfinden
können, sondern weil man auch in allen Veränderungen nach
eigenem Belieben stark und schwach verfahren kann...“
Das Wesen des Pantalons oder Pantalon-Claviers kann aufgrund
verschiedener Quellen unterschiedlich interpretiert werden. Die
klangliche Verwandschaft von Hackbrett und frühen
Hammerklavieren wird im besondes leichten, tremolierenden Spiel
deutlich. Dazu eignen sich besonders die leichten, dünn- oder
unbelederten Hammerköpfe aus Holz, Bein oder Horn mit relativ
langem Hammerstiel wie z.B. in den Tafelklavieren von Christian Baumann
aus Zweibrücken.
.
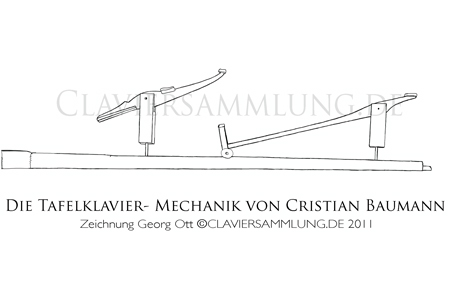 .
.
Ein
verbindendes Merkmal könnte auch eine, durch Handzüge,
Kniehebel oder Pedal zu schaltende Stufendynamik sein,
entsprechend den, am Instrument Hebenstreits zur Verfügung
stehenden Registern: Metallsaiten, Darmseiten, angeschlagen durch
belederte oder unbelederte Hämmer und den sich daraus ergebenden
Kombinationen.
Die gängigen Veränderungen sind:
1.
xxPianozug
(Moderator): Reduzierung der Lautstärke durch Einschieben von
Tuchstreifen zwischen Hammer und Saite, gelegentlich auch mehrere
unterschiedlich starke Moderatoren in einem Instrument.
2.
xxFortezug –
Dämpfungsaufhebung, die angeschlagenen Töne klingen frei aus,
bis Ende des 18. Jh. häufig für Bass und Diskant getrennt zu
betätigen.
3.
xxForte- und
Pianohämmer: für einige wenige erhaltene Instrumente stehen
je Ton zwei seperate Hammerreihen zur Verfügung, die alternativ
mit und ohne Belederung angeschlagen werden.
4.
xxUna corda
(Harmonikazug): Hierbei wird die gesamte Tastatur seitlich verschoben,
so dass nur eine Saite eines Chores angeschlagen wird.
5.
xxHarfen-, Fagott-,
Cembalo-, Lautenzug etc.: Klangveränderungen, die zumeist dudurch
erzielt wurden, dass Leder, Tuch , Elfenbein oder Papier an die Saiten
gedrückt wurden.
Drittens wird auch das gänzliche Fehlen einer Dämpfung
gelegentlich als Pantalon- Merkmal genannt. Sicher ist, dass das
„Untereinandersausen“ der Töne im Klangkonzept eines
Pantalon- Claviers nicht unbedingt als unangenehm empfunden wurde.
„Das
ungedämpfte Register des Fortepiano ist das angenehmste, und wenn
man die nöthige Behutsamkeit wegen des Nachklingens
anzuwenden weiß, das reizendeste zum Fantasieren“ C. P. E.
Bach
„Denn wenn man da fürnehmlich einen Baß-Clavem
anschlägt, so klingt er, ungeachtet es mit Darm-Saiten bezogen,
wie einer, der auf einer Orgel gehalten wird, lange nach, und lassen
sich da viele Passagien und Resolutiones der Dissonantien mit
größter Wollust des Gemüths absolviren, ehe er
gänzlich verschwindet."
Anhand vieler Beispiele lässt sich zeigen, dass die Beliebtheit
des Klangs der ungedämpften Saite keineswegs eine Marotte einiger
weniger Klavierbauer war, sondern bis in die zweite Hälfte des
Jahrhunderts hinein zu den wichtigsten ästhetischen
Grundprinzipien zählte.
Historische Quellen, Berichte und Anzeigen verwenden den Begriff
Pantalon um 1750 scheinbar sehr frei- für Hackbrett oder
Clavierinstrumente. Die Begriffsverwirrung der doch grundlegend
verschiedenen Anschlagsarten hat ihre Ursache sicherlich in dem
Bestreben, die faszinierende aber akrobatische Hackbrettspielerei
durch eine zwischengeschaltete Mechanik den Clavierspielern
zugänglich zu machen. Vermutlich wurden unter dem Titel
Pantalon unterschiedlichste Mechanikformen ausprobiert, welche als
Verbindungsglieder eine fließende Bedeutungs- Verlagerung zum
Hammerclavier begründen.
„Pantalongs von allerley Facon
und Größe, dessen sehr lieblichen Töne, ohne den
sonstigen Nachklang, nunmehro gleich einem Clavicimbel tractiert werden
können, und dahero in allen Concerten mit Nutzen zu gebrauchen
sind, nicht allein, weil aller unzeitiger Nachklang gedämpfet,
worauf bereits viele speculiret und nicht erfinden können, sondern
weil man auch in allen Veränderungen nach eigenem Belieben stark
und schwach verfahren kann...“
Noch einfacher als mit Tastendruck, lässt sich der Pantalon-Klang
mit Hilfe einer Cymbal-spielenden Androide vernehmen. Der begnadete
Uhren und Instrumentenbauer Christian Kintzing aus Neuwied baute diesen
real- spielenden Atomaten für die französische
Königin Marie Antoinette
"Johann Andreas Stein- der den rohen Pantalon in das Fortepiano umwandelte"
Mit der Einführung der Kniehebelschaltung zur
Dämpfungsaufhebung 1769 eröffnet Johann Andreas Stein neue
Ausdrucksmöglichkeiten die allmählich das stufendynamische
Registerkonzept des Pantalon-Claviers ablösen werden.
„Der Zug, welcher
die Dehnung oder Staccato macht, und sonsten zu beiden Seiten des
Claviers eine Beschäftigung der Hände war, wird hier durch
eine kleine unvermerkte Bewegung des Knies bewürkt; welches in der
That ein sehr groser Vortheil ist, wenn man einzelne Noten, Passagen
und Manieren scharf abstossen oder stokiren kann, ohne die Hände
vom Clavier zu bringen“
Nach Entwicklung der Steinschen Prellzungen- Mechanik mit
belederten Hämmer 1782, breitet sich auch in Deutschland
ein, auf feinste dynamische Modulierbarkeit des Tones orientiertes
Klangkonzept aus, welches in Konkurenz zum Pantalon- Modell
tritt. Die Instrumentenbauer und Anhänger der beiden Lager
streiten indes noch Jahrzehnte verbittert über Vorzüge
und Nachteile.
„Andreas Stein,
mit vollem Rechte berühmt (...) als Erfinder einer Mechanik,
die den rohen Pantalon in das, jetzt überall eingeführte
Pianoforte umwandelte“
Da sich das Pantalon-Konzept bis Ende des 18. Jahrhunderts
überwiegend in Form kleinerer deutscher Tafelklaviere verbreitet
ist dieser Konflikt auch ein Kampf zwischen kleinen und großen
Instrumenten. Daraus darf aber nicht etwa abgeleitet werden, dass die
Hammerklaviere der neuen Art in erster Linie durchsetzungsstärker
und lauter zu sein hatten, im Gegenteil, zunächst ging offenbar
das Bemühen des Stil -prägenden Augsburger
Instrumentenbauers Johann Andreas Stein dahin, ein bis ins
Unhörbare verfeinertes Diminuendo zu ermöglichen. Johann
Friedrich Reichardt schreibt darüber:
„Ich dachte einer
interessanten Scene, die ich einst mit dem ächt genialischen
Instrumentenmacher Stein in Augsburg hatte. Ich besuchte ihn , um
ein neues Instrument, das er damals eben erfunden und für seine
Tochter gemacht hatte, zu hören, auf welchem man das Cescendo und
Diminuendo auf eine sehr vollkommene Art sollte ausüben
können. Das müssen sie von meiner Tochter selbst hören,
die weiß damit umzugehen! rief der alte Künstler mit doppelt
frohem Bewußtsein. Es ward nach der Tochter geschickt, in der in
hernach eine vortreffliche Klavierspielerin kennen lernte. Während
dessen aber konnte der alte Meister doch nicht unterlassen, mit die
Natur des Instruments mit vieler Liebe und mit großem Eifer zu
beschreiben, und um mir die Vollkommenheit des Diminuendo zu schildern,
sagte er mit den angespanntesten Sinnen und Gebehrden: „Sie
glauben zuletzt noch immer was zu hören. Sie hören aber
nichts, gar nichts, rein gar nichts.“ Es war unter den
Händen der feinen Künstlerin auch wirklich so. Ich
wünschte daß Herr Stein nicht mag bei seinem Vorsatz
geblieben seyn, dergleichen Instrumente, der vielen Arbeit wegen,
(nicht) weiter zu verfertigen. Es war wahrlich die Krone seiner
überaus feinen genialischen Arbeit.“

Aber es gibt auch die Bewahrer des, ganz auf Klang- Register und die
gewohnten meist kleinen Instrumente setzenden Freunde der „alten
Musik“ Einer der einflussreichsten Vertreter eines
unumstößlichen Pantalon- Ideals ist Johann Peter Milchmeyer:
„Hat man unter
Instrumenten verschiedener Art die Wahl, so würde ich anrathen,
daß man das kleine viereckige Pianoforte dem grosern vorziehe.
Das grose braucht mehr Platz, vermehrt die Unkosten des Transports auf
Reisen, und hat weniger Veränderungen als die kleinen, da doch
diese Veränderungen so viel Wirkung thun, und immer mehr Beyfall
gewinnen “
darauf entgegnet ein Kritiker in der Allgemeinen musikalischen Zeitung im November 1798 zu Milchmeyers Klavierschule
„Dies mochte wohl
das schwächste Kapitelschen im ganzen Werk seyn. Der Verf.
räth, sich die kleinen viereckigten Pianoforte’s zu kaufen
– warum? Weil mehr Züge und Veränderungen dran sind!
Diejenigen Instrumentenmacher kann er nicht genug loben, welche - viele
Züge und Veränderungen an ihre Instrumente machen! (...) Wir
Deutschen wollen doch lieber bey unsern Stein’schen Instrumenten
bleiben, auf denen man, ohne Züge, alles machen kann.“
Zu dieser Zeit ist allerdings auch Steins gerade mal 15 Jahre alte
Prellungenmechanik von 1782 schon fast ein Relikt deutscher Orgel-und
Klavierbau Geschichte. Die neuen, sich überschlagenden Klavier-
Entwicklungen werden nicht mehr in Augsburg sondern in London, Paris
und vor allem Wien vorangetrieben, und es sind dort nicht zuletzt
technologische Neuerungen und eine, auf fortschreitende Arbeitsteilung
ausgerichtete Klavier- Produktion. Dabei darf jedoch nicht unbeachtet
bleiben in welches unvorstellbare und anhaltende Elend gerade Augsburg
mit Ausbruch der Revolutionskriege gerissen wurde. Christian Friedrich
Daniel Schubart notierte auf der Durchreise schon 1793,
"scheinen eine solche Katastrophe zu vermuten und leben meist wie
Leute, die alles aufzehren, damit der Feind nichts mehr bei ihnen
finde"
Es kam wohl noch schlimmer als vermutet. 1796 rückte General
Moreau ohne alle Rücksicht auf einen vereinbarten Waffenstillstand
in das militärisch geräumte Augsburg ein. Die wechselnde
Kriegslage ließ in den folgenden Jahren abwechselnd
Revolutionstruppen und Kaiserliche die Stadt plündern. Die enormen
Kriegslasten und Erpressungen summierten sich allein zwischen 1796 und
1799 auf einen Gesamtwert von 1,1 Mio. Gulden. An Klavierbau war
wohl auf Jahre nicht mehr zu denken. Nannette und Andreas
Matthäus, die Kinder Johann Andreas Steins folgten dem
Auswanderer- Strom nach Wien, wo sie bedeutende moderne Klavierbau-
Unternehmen gründeten. Einige zogen sich wohl in die Provinz
zurück, wo bis weit ins 19. Jahrhundert einzelne Klavierbauer als
„schwäbische Kleinmeister“ an der Einzelfertigung
längst veralteter Claviermodelle festhielten. Aus diesem
Umfeld stammt wohl auch eines der letzten, in der Pantalon- Tradition
gebauten Claviere, erbaut von Jac. Fried. Heinzelmann
Instrumentenmacher in Eberdingen 1819.
bei Interesse kann ein Manuskript mit Quellenangaben angefordert werden
Sylvia Ackermann und Georg Ott
© georg ott CLAVIERSALON 2010

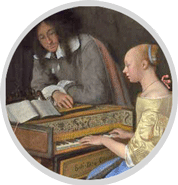

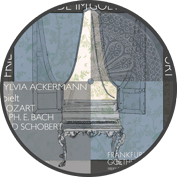

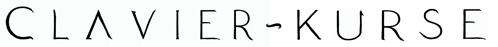


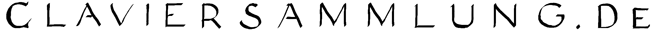


 .
.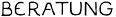
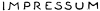
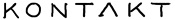

 . .
. .