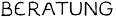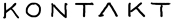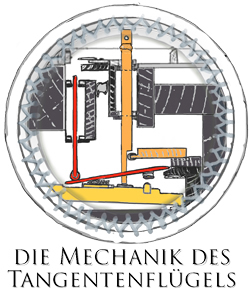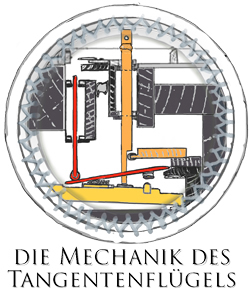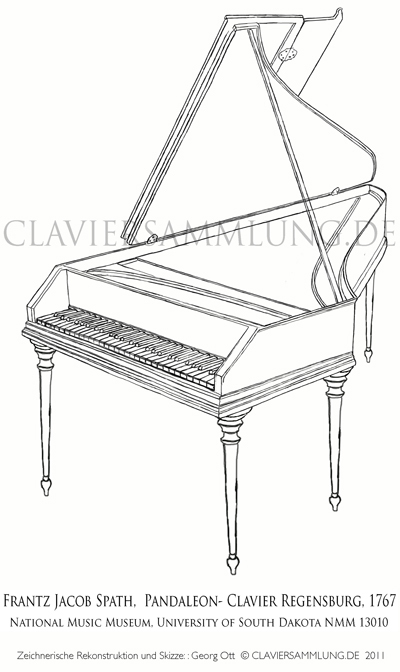| Regensburg und die Erfindung des Tangentenflügels |
.
. |
"Schmahl
und Spath in Regensburg haben seit einigen Jahren eine von ihnen
erfundene Flügelart in alle 4 Weltteile verbreitet, welche den
Namen Tangentenflügel führt. Sie ist ein Mittelding zwischen
Fortepiano und bekieltem Flügel und wird von denjenigen zum
täglichen Gebrauche nicht ohne Grund gewählt, welchen es an
Zeit gebricht, einen bekielten Flügel immer in guten Stande zu
halten, oder an Geld, ihn durch einen Instrumentenmacher darin erhalten
zu lassen..."
|
|
.
1791, musikalische Korrespondenz der
deutschen Filharmonischen Gesellschaft
für das Jahr 1791 No 2/10
erste bekannte Erwähnung des Wortes „ Tangenten-Flügel“
.
.
. |
| Tangenten und Tangentenflügel |
Die
Erfindung des Tangentenflügel in der Regensburger Werkstatt von
Franz Jakob Spath und Christoph Friedrich Schmahl kann als
gesichert betrachtet werden. Immer wieder geäußerte Zweifel
an der erfolgreichen Regensburger Urheberschaft führen gerne
den Begriff "Tangente" in früheren Quellen an, was etwa so
überzeugend ist, wie mit dem Begriff "Hammer" die Existenz von
Hammerflügeln belegen zu wollen. Der Begriff "Tangente" wurde
vor und nach Spath & Schmahls Erfindung willkürlich in ganz unterschiedlichen
Zusammenhängen verwendet, so etwa für auch für
Cembalo- Springer und Hammerklavier- Hämmer und Dämpfer. Die
Begriffsverwirrung hält sich z. T. bis ins 19. Jh. und sorgt auch heute noch für interessante Thesen bei einigen
Instrumentenkundlern, gerne auch mit Hinweis auf Gerbers Lexikon von 1813:
"Spath
(Franz, Jakob) – Orgel und Instrumentmacher zu Regensburg, von
dem schon im a. Lex. unter dem Artikel Spath einiges gemeldet worden
ist, überreichte schon 1751 dem Churfürsten zu Bonn einen
Tangent-Flügel mit 30 Veränderungen, und hatte durch seinen
Fleiß dies Instrument im Jahre 1770 bis zu 50 Veränderungen
gebracht. Von seinen Orgelwerken kann ich nur das einzige in der
Dreyfaltigkeitskirche zu Regensburg, von 29 Stimmen mit 4 Bälgen,
nahmhaft machen, welches er schon 1758 erbaut hat. eine Anzeige von
seinem Instrumente findet man in Hillers Nachrichten.B.IV.S.142 Er
starb ums Jahr 1796"
Ernst Ludwig Gerber: Historisch-Biografisches Lexicon der Tonkünstler, Leipzig 1813/14, IV, 538
Michael Latcham etwa, nimmt die Begriffsverwirrung des alten Gerber zum
Aufhänger für seine These, dass Tangentenflügel bereits
Mitte des 18 Jh. gebräuchlich waren. (siehe Michael Latcham: „Franz Jakob Spath and the Tangentenflügel“ Galpin, May 2004, S. 161), dabei liegt nahe, dass Gerber lediglich bei seinem Kollegen
Jacob Adlung frei abgeschrieben hat, der bereits 1758 in seiner Anleitung zu der musicalischen Gelahrtheit (Erfurt: J.D. Jungnicol, 1758) Seite 576-577, jenes Instrument für den Bonner Churfürsten schlicht als "Clavier mit 30
Veränderungen ...forte, piano, pianissime, ein Echo, Harfe, Laute,
Pandaleon und ordentliche Flaute Traver" bezeichnet.
Tatsächlich gibt es bisher keinen einzigen halbwegs
überzeugenden Hinweis auf die Existenz von Tangentenflügeln
in der bekannten Form vor den 1780er Jahren, womit auch bis auf
weiteres geklärt sein sollte, das Mozart in seinen Briefen
von 1777 keinen
Tangentenflügel gemeint haben kann, sondern eben die frühen
Hammerflügel der "spättischen" Werkstatt entsprechend dem des
National Musik Museum, Vermillion, NMM 13010.
Wer in der Erfinder-Frage weiter auf Tangenten - Suche ist,
wird sicherlich noch verschiedene Quellen und Skizzen finden, die
tangentenmechanische- Übereinstimmungen zeigen, angefangen bei
Arnold von Zwolle bis hin zu Chr. Gottlieb Schröter.

Die Leistung von Franz Jacob Spath
und
Christoph Friedrich Schmahl
besteht jedoch nicht in der erstmaligen Anwendung einer Mechanik- mit
Tangenten, sondern in deren genialen, wirkungsvollen und
belastungsfähigen Umsetzung! Die Mechanik ist in ihrer konkreten
Form so ausgereift und gewissermaßen "unverbesserbar" dass der
Begriff "Tangentenflügel" als Gattungsnahme für eine eigene
Instrumentenform mit Spath und Schmahls Erfindung wie ein
Stern auf ... und nach etwa 15 Jahren ebenso schnell wieder
untergeht (was wohl der um1800 rasanten
Klavierentwicklung geschuldet ist) . In diesem Sinne ist die
Erfindung des Regensburger
Tangentenflügels eine einzigartige Leistung in der Geschichte des
Instrumentenbaus.
.
|
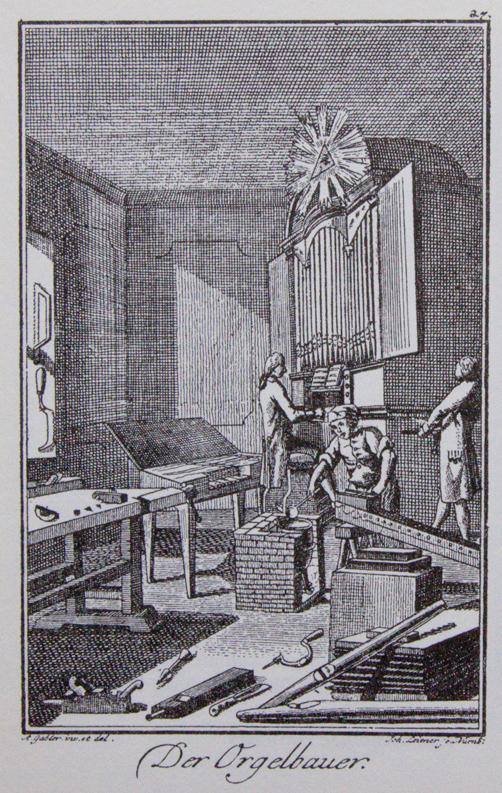 |
| "Der
Orgelbauer" Kupferstich von Johann Sebald Leitner nach Ambrosius
Gabler, Nürnberg um 1790- dem Erbauungsjahr des Sulzbacher
Tangentenflügels. In der Werkstatt des Orgelbauers ist neben
diversen Werkzeugen und Orgelteilen, eine Gießlade und neben der
Orgel im Hintergrund auch ein Tasteninstrument zu erkennen. Zahlreiche
deutsche Orgelbauer entwarfen und bauten auch unterschiedliche
besaitete Tasteninstrumente, darunter Clavichorde und Hammerklaviere.
Die grassierende Klavier -Lust des späten 18. Jh erschloss dem
traditionellen Orgelbau damit eine breite bürgerliche
Geschäftsgrundlage. Aber auch die, in der Folge der
Revolutionskriege erfolgte Enteignung Kirchlicher Güter,
zwang wohl viele Orgelbauer, sich verstärkt um bürgerliche
Kundschaft zu bemühen. |
|
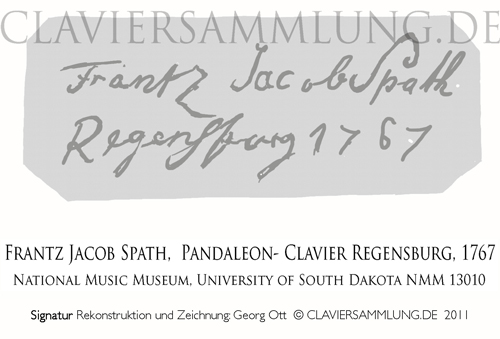 |
| . |
| und was sagt die Konkurrenz dazu? |
Gottfried Silbermann über Franz Jakob Spath:
. |
.
„Dieser Künstler macht von seiner Clavessin-Arbeit [...]
erschröcklichen Wind. Ein Herr von Waldburg, der 1777. bey uns war, hat
seine Instrumenten gesehen und will nichts rühmliches sagen.“
. |
.
.
.
|
,,... |
..
Die Erfindung des Tangentenflügels fällt, den bekannten Zeugnissen
entsprechend, auf die erste Hälfe der 1780er Jahre. Zu dieser Zeit war
der weithin berühmte Instrumentenbauer Franz Jakob Spath (1714–1786)
bereits an die 70 Jahre alt, so dass wir davon ausgehen können, dass es
wohl maßgeblich Spath’s Schwiegersohn Christoph Friedrich Schmahl war,
der den Tangentenflügel entwickelte und baute. Der aus Heilbronn stammende Orgelbauer Christoph
Friedrich Schmahl (1739–1814) heiratete 1772 Spaths Tochter Anna
Felicitas und trat bald danach unter dem Namen „Spath und Schmahl“ als
Teilhaber auf.
Die Orgelbauer-Werkstatt Spath ist seit dem 17.
Jh. in Regensburg nachweisbar. Neben verschiedenen Orgeln sind zwei sehr
frühe Hammerklaviere von Franz Jakob Spath erhalten, eines im
National Music Museum der University of South Dakota in Vermillion/ USA und ein
weiteres, jüngst aufgetauchtes Instrument welches derzeit im
Greifenberginstitut für Musikinstrumentenkunde steht.
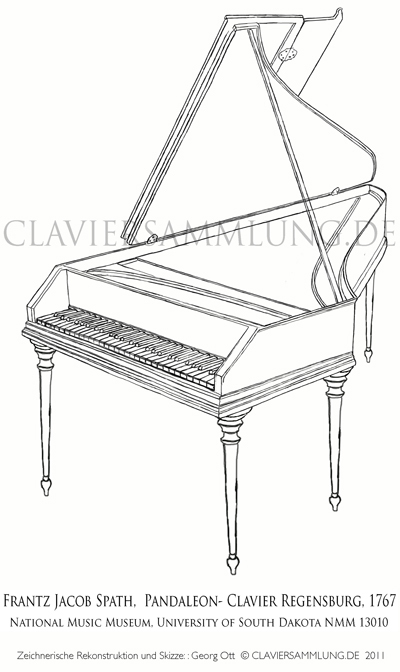
In der Anlage und
Struktur stehen alle erhaltenen Hammer- und Tangentenflügel der Regensburger Werkstatt in einer
sehr dichten Kontinuität, das heißt, dass wesentliche Merkmale der
Konstruktion und in der äußeren Erscheinung der Instrumente
übereinstimmen .
.
.
.
.
.
.
Christoph Friedrich Schmahl in Regensburg
1774
findet die Firma des Schwiegervaters Franz Jakob Spath erstmals unter
dem Namen „Späth und Schmahl“ Erwähnung.
1784 kaufte das Ehepaar Schmahl von den Stadthafnersleuten
Eichinger für 2600 rheinische Gulden die Hafnerbehausung nebst
Hofstatt und Garten „Unter den Schiltern am Eck“ neben dem
Haus von Späth in der Wildwercherwacht
Schmahl
erhält das ehrenvolle Amt eines Hansgerichtsassessors; er war also
in Angelegenheiten der Handelsgerichtsbarkeit am Ort tätig
1786 stibt der Schwiegervater Franz Jacob Späth und die Ehefrau Anna Felicitas
Chr. Fr. Schmahl führt die Firma bis 1802 allein weiter bis er im
Alter von 63 Jahre seinen älteren Sohn Jacob Friedrich Schmahl
(1777–1819) zur Arbeitsentlastung ins Geschäft aufnimmt;
dieser heiratete Susanne Christine Bernhardine Säger
(1774–1847) aus Heilbronn, die vermutlich aus der
Späth-Familie stammte und ihm 1809 die Tochter Elisabetha gebar.
1812 bat der jüngere Sohn Christian Carl Schmahl (1782–1815)
bei der Stadt um Aufnahme als Bürger sowie als Orgel- und
Instrumentenmacher, um anstelle seines greisen Vaters das Geschäft
mit seinem Bruder fortführen zu können. Einen
gewöhnlichen Lehrbrief könne er nicht vorweisen, er habe aber
ein Adventitiengut von 2169 Gulden aus der Erbschaft von seiner Mutter
und den Großeltern; der Vater sei wohl imstande, sich und den
Rest der Familie von seinen eigenen Grundstücken und dem
übrigen Vermögen zu ernähren und wäre geneigt, ihm
ein Holz- und Werkzeugsortiment für die Ausübung des
Geschäfts zu überlassen. Das Gesuch wurde von der
Polizeidirektion im Sinne folgender Erwägung angenommen:
„Die Musikinstrumente von Schmahl sind die berühmtesten und
der Staat kann auf den [5/6] Besitz solcher Künstler stolz
sein.“ Nach dem Tod des Vaters wurde die Firma unter dem Namen
„Schmahls Söhne“ oder „Gebrüder
Schmahl“ bis 1815 weitergeführt, als der jüngere der
Brüder unverheiratet verstarb und der ältere das einstmals
blühende Geschäft aufgab. Im Dezember des gleichen Jahres
kaufte dieser die Brauerei des Georg Adam Haller und führte
sie mit Genehmigung, obwohl des Brauwesens nicht kundig, bis zu seinem Tod.
.
.
nähere Informationen
|